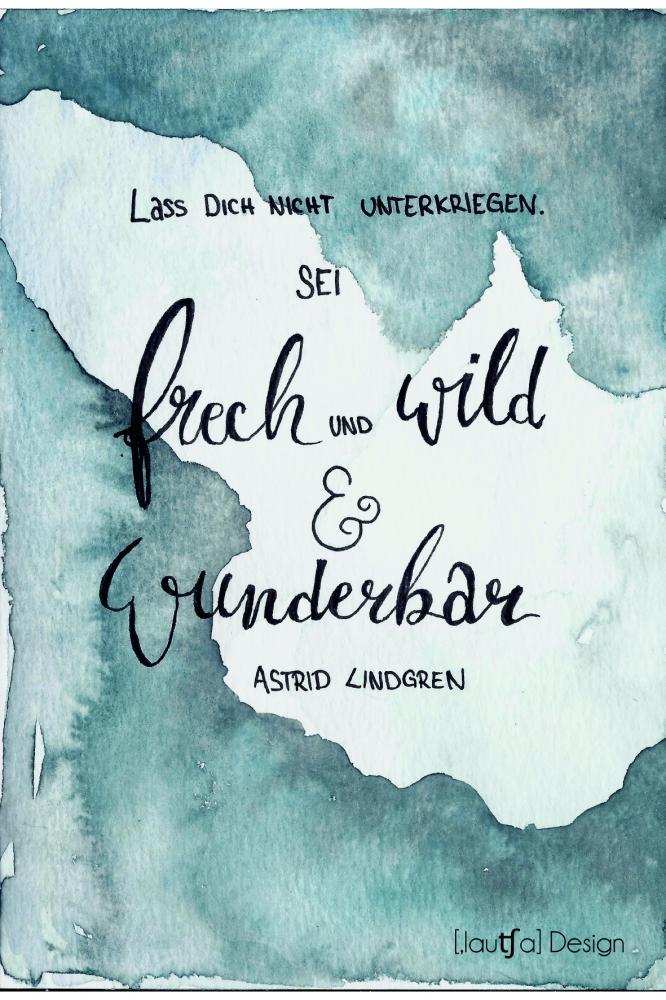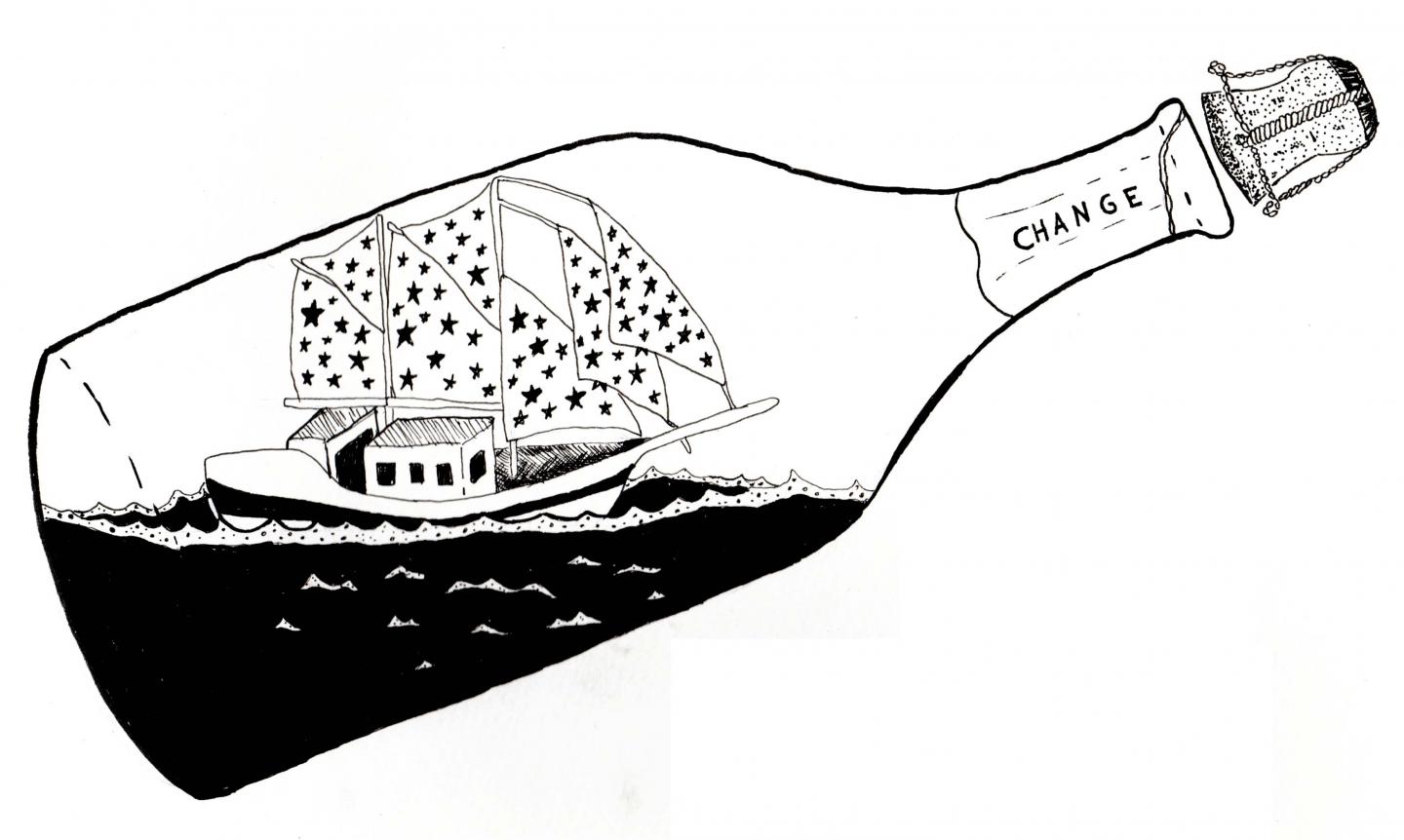Einsam vereint
#DunkelDuscht #Seelenleben #LebenLernen
Über das hoch stilisierte Know-how und das schwindende Know-why der eigenen Existenz, und was es mit der Enttabuisierung der Einsamkeit auf sich hat – eine Kolumne von Herrn Dunkel.

In Großbritannien wurde unlängst ein Regierungsposten gegen Einsamkeit eingerichtet. Man lächelt und grübelt, schließlich wird es auch auf der Insel keine unbegrenzten Möglichkeiten bei der Ausgestaltung und Etablierung politischer Ressorts geben. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach wünscht sich eine solche Instanz nichtsdestotrotz auch für Deutschland, vielleicht innerhalb des Gesundheitsministeriums, und mahnte in diesem Zusammenhang in der BILD, „die Einsamkeit in der Lebensphase über 60 erhöht die Sterblichkeit so sehr wie starkes Rauchen“. Einsamkeit tötet also, weshalb auch der familienpolitische Sprecher der Union, Marcus Weinberg, eine „Enttabuisierung“ des Themas fordert, damit „einsame Menschen eine Lobby“ bekämen und sich so zumindest schon einmal im Spiegel der gesellschaftlichen Zuwendung aus ihrer Vereinzelung befreien. In Großbritannien, so die neue Ministerin für Einsamkeit Tracey Crouch, fühlten sich etwa 9 Millionen Menschen sozial isoliert und etwa 200.000 der älteren Menschen hätten höchstens einmal im Monat ein Gespräch mit einem Freund oder Verwandten. Wenn man also mal ein gewisses Alter erreicht-, und sich der eigene Nachwuchs erfolgreich entkoppelt hat, gehen einem im erheblichen Maße die Menschen aus, die einen mit dem Vornamen ansprechen, und man verliert im Laufe der Zeit zwangsläufig die Ahnung davon, wer man einmal war, so als Mitmensch, und dann hört man schließlich buchstäblich auf zu sein, man vergeht.
Indes, nicht jeder, der allein ist, ist einsam, gleichwohl kann man sich auch mit vielen realen und virtuellen Freunden umgeben und spürt doch nur seelische Ödnis. Was ist Einsamkeit? Rebecca Nowland, promovierte Psychologin mit Lehrauftrag an der Universität Manchester, beschreibt Einsamkeit als einen subjektiv erfahrenen Zustand, in dem die Menschen ein Missverhältnis fühlen zwischen den zwischenmenschlichen Beziehungen, die sie haben und jenen, die sie gerne hätten. Diese Definition ist soweit wissenschaftlicher Konsens. Darüber hinaus beschreibt Nowland die Alterskohorte der heute 18-35-Jährigen, die Generation Y, als besonders gefährdet, der Einsamkeit anheim zu fallen und nennt es das „Bridget-Jones-Phänomen“. Bridget Jones. Man sieht sich versucht zu spotten. Entschuldige, falls es dich betrifft. Da ist sie also, die Generation der kuratierten Leben, die ihr ach so einzigartiges Dasein zur Kunst stilisiert und die sich mit viel Know How und schwindenden Know Why zu Chronisten der eigenen Existenz erheben. Die Frage nach dem passenden Face-Filter schiebt sich vor das eigene Erleben, aber dann, am Ende des Tages, an dem sie alle wieder so mobil waren, so unverbindlich, so dezentralisiert, an dem sie effizient kollaboriert – vielleicht sogar kopuliert –, ihre persönlichen Fitnesswerte getrackt und stabilisiert haben, an dem sie ungezählte Interaktionen hatten, die sie auf der Habenseite addieren, sitzen sie abends mit Schokolade und einer Box Taschentücher auf der Bettkante und sind trotz aller gesammelten Likes und Friends’n’ Flames allein und einsam, weil sich das alles nicht anfühlt. Es ist wie bei den vermaledeiten Piraten in Fluch der Karibik: aller Völlerei zum Trotze lässt sich ihr Hunger einfach nicht stillen. Trifft sie der Fluch zurecht, sind sie alle selber schuld? Oder sind sie Opfer des Zeitgeistes und der Durchökonomisierung des menschlichen Seins? Oder beides?
Auch die Einsamkeit an sich hat etwas Janusköpfiges. Schaut man in die Literaturgeschichte und bleibt etwa in den Epochen der Empfindsamkeit und Romantik hängen, so blickt man auf die Einsiedler, die Eremiten, die Wanderer, die sich loseisen, sich abschotten, auf Wanderschaft begeben, um in der Zurückgezogenheit die Sinne zu erweitern und zu schärfen. Oder eben Rückzug ins Innere. Für den Romantiker Novalis wird die Reise in die Tiefen des eigenen Gemüts, in das eigene „innere Bergwerk mit seinen verborgenen Geheimnissen, Schätzen und Gefährdungen“ zum romantischen Projekt par excellence – innerhalb der Grenzen des eigenen Inneren spiegelt sich der Kosmos als Ganzes. Da braucht man dann wahrlich keine anderen Leute mehr. Ab dem 19. Jahrhundert war es das dann aber mit wonniger Waldeinsamkeit bei frischer Luft und Vogelgezwitscher und schlegelscher Universalpoetik; mit Kafka und Camus wurde es frostiger, grundsätzlicher, kalt und technisch. Mit der Moderne wandelte sich der Topos der Einsamkeit hin zu etwas Destruktiven. Es ist wie mit jenem „Mann, der Inseln liebte“, dem Protagonisten aus der gleichnamigen Erzählung von D.H. Lawrence, der, auf der Suche nach seinem persönlichen Paradies sein Dasein auf immer entlegenere, kleinere und lebensfeindlichere Inseln verpflanzt und am Ende, so ganz allein und im Angesicht der Kargheit der selbst gewählten Lebensumgebung der unsentimentalen Kraft der Elemente erliegt. Der Mensch scheint nicht dafür gemacht, einfach nur sich selbst zu leben und doch wird er in all seiner Einzigartigkeit, nackt und sehnend in die Welt gesetzt und zwar ganz so, wie José Ortega y Gasset in seinem Werk Der Mensch und die Leute schreibt, wie Jesus am Kreuz aus der Welt geschieden ist: mutterseelenallein, ängstlich, verloren. „Deus meus, deus meus, ut quid derlinquisti me?“ – „Mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen?“ – und indem er sich fragend, gar vorwurfsvoll an seinen göttlichen Vater wandte, vollzog der künftige Erlöser, wenn man sich mit dieser Heilsvorstellung anfreunden kann, einen letzten, recht eindrücklichen Akt der Menschwerdung. Einsamkeit und zwar die „radikale Einsamkeit“, wie der spanische Philosoph schreibt, ist Zurückbleiben, Alleinsein und Vermissen. Es wird zum Grundantrieb des menschlichen Seins. Der Mensch kann nicht nur für sich existieren, er muss in reziproke Seinsverhältnisse treten, inter- bzw. koexistieren, Beziehungen aufbauen. Der Mensch fängt im Kontakt mit den anderen erst an, wirklich im Leben anzukommen, wir vervollständigen uns, vielleicht, weil wir schon immer zusammengehörten, mal zusammen waren, wie die Kugelmenschen bei Aristophanes, dann getrennt wurden und uns dann wieder auf die Suche nach dem Anderen begaben. Die Liebe ward geboren. Das ist es! Das Schlusswort unter dem heutigen philosophischen Geschwurbel: Lasst uns wieder mehr Liebe wagen! Ein Ministerium für die Liebe täte uns vielleicht auch ganz gut! Nur wen dann als Ministerin oder Minister ...? Nun, lasst es uns nicht zerstören ...
PS: Dieser Artikel erschien erstmalig in der 10. Ausgabe des VONWEGEN-Magazins im März 2018.
Ihr mögt unseren Stoff zum Reinziehen?
Dann spendet uns gerne ein paar Kröten in unsere Kaffeekasse. ♥
Weiterschmökern auf der Startseite...