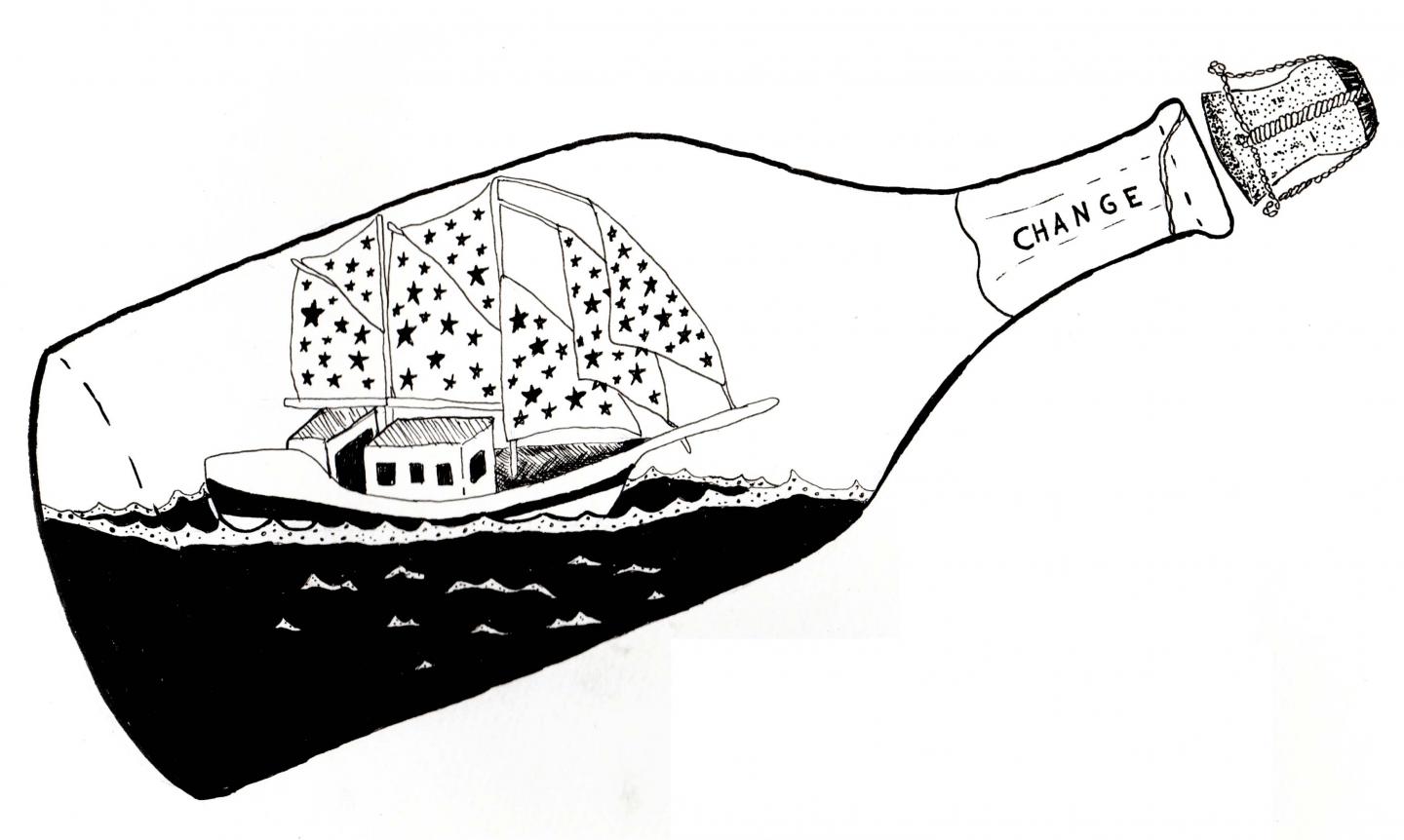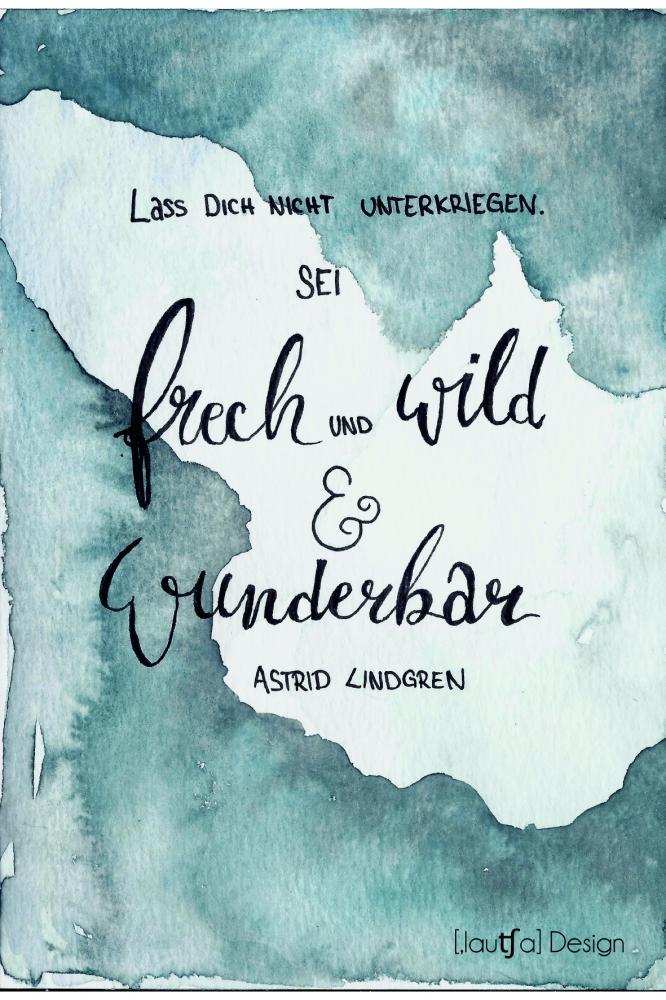Drang und Druck zur Veränderung
#DunkelDuscht #Seelenleben #LebenLernen
Wieviel Aktivationsenergie braucht es, um das Vehikel unseres Selbst aus dem Orbit seiner Begrenzungen zu schießen? Und wo treibt es einen dann hin? Das fragte sich aus akutem Anlass unser Kolumnist Herr Dunkel, der die Mäusestrategie schon damals gar nicht unbedingt für Käse hielt, auch wenn sie zum Himmel stank.
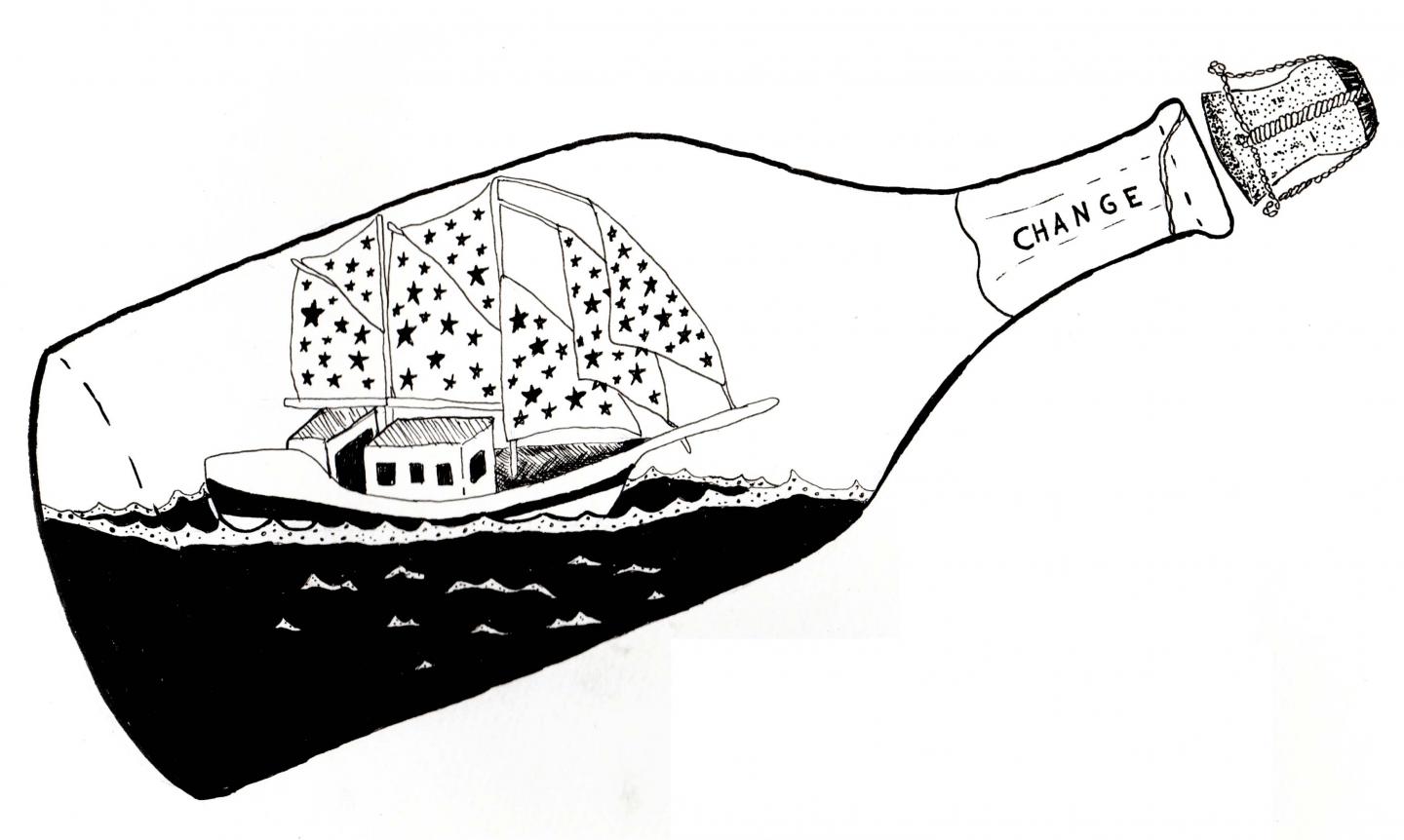
Die Welt um uns herum erschlägt mit allzu Naheliegendem und profanster Offensichtlichkeit, dass man zuweilen in Passivität regelrecht erstarrt, und so habe ich dankbar zur Kenntnis genommen, dass sich durch diese VONWEGEN-Ausgabe ein roter Faden schlängelt. Ich nehme ihn auf, wenn Ihr erlaubt.
Nun, ist nicht bereits die Feststellung, dass sich der Mensch stetig verändert, schon allein deshalb, weil er auf äußere Bedingungen zwangsläufig reagieren muss, um fortzubestehen, ein so selbstverständlicher Befund, dass es sich kaum lohnt, darüber zu sprechen? Oder sind eben diese Anpassungsprozesse von jeher so reibungsvoll gewesen und sind es noch, dass eine Thematisierung dieses Phänomens verstetigt gehört? Die Wahrheit gehört wahrscheinlich irgendwo in die Mitte auf die gelben Moderationskarten. Untrennbar mit dieser grundlegenden Frage ist verbunden, will man denn etwas Urteilendes zum Prozess der Veränderung sagen, ob sie, die Veränderung, als Impuls zur eigenen freiheitlichen Selbstentfaltung herbeigeführt werden soll, oder ob dieser von außen kommt, als Diktum und zwar in Sinnverwandtschaft zum Wort Diktat. Die Diktatur des Sich-Verändern-Müssens, egal ob als Herrschaftsform oder nur als Mantra gedacht, kennt verschiedenste Ausprägungen und soziale Reichweiten. Das Kleinkind wird erzogen, um ein für die Gesellschaft angenehmes Mitglied zu werden, es wird geformt, geschliffen, mal liebevoll oder auch mit Gewalt; später wird es im Sozialen subtiler, der interpersonelle Druck verschleierter, unausgesprochen, aber immerzu spürbar. Im Arbeitsleben wie auch in der Schule oder im Studium, wo wir in Strukturen unterschiedlicher Weisungsbefugnisse und Abhängigkeitsgefüge eingewoben sind, wo die Wirkung unseres Tuns mal mit Kompetenz, mal mit Effizienz in Beziehung gesetzt wird, findet man mitunter deutlichere Worte, wird der Druck, sich verändern zu müssen, wieder konkreter. Der Druck, metaphorisch als Schlag ins Gesicht gemalt, hinterlässt dort bleibende Dellen, wir tragen sie als Geschundene durch unser Leben. Der Blick in die Neurophysiologie des Menschen lehrt, dass unser Gehirn und Nervensystem, also genauer gesagt, deren neuronalen, d.h. synaptischen Verschaltungen, eine funktionale und sogar strukturelle Plastizität aufweisen. Unser zentraler Prozessor, der unsere Umwelt auswertet und unser Innenleben gestaltet, verändert sich mit der Art und Weise, wie man ihn befeuert oder wahlweise füttert. Exakt hier klafft der Spalt zwischen Chip und Mensch, den die Künstliche Intelligenz zu füllen trachtet. Für uns bedeutsam erscheint, in einem weiteren Bild gesprochen, zunächst, dass sich der Sound, die Anschlagdynamik und das Repertoire unseres inneren Klaviers verändert, wenn man es so oder so bespielt. Ein erster Schritt zur Veränderung schließt daher ein, sich darüber Gewissheit zu verschaffen, welche Hände über die Klaviatur unseres Innersten gleiten, d.h. für sich zu klären, welche Kräfte auf einen wirken.
Der nächste Schritt, dies sei nur skizziert, bedeutet die Klärung dessen, was von dem, was da auf uns wirkt, uns stärkt oder schwächt, uns Energie gibt oder sie uns nimmt, uns groß macht oder klein macht, und damit dies alles nicht nur Nabelschau bleibt, muss der Phase der Kontemplation eine Phase des Handelns folgen und Fakt ist und bleibt, dass nicht alles, was mal geändert gehört, auch in unseren Händen liegt: weil wir abhängig sind, ökonomisch oder emotional, weil wir Ängste eben nicht als Treibmittel, sondern als unüberwindbare Hürden empfinden. Und da sind freilich noch die Schicksalsschläge, die über uns herfallen wie ein Meuchelmörder in der Nacht, deren unheilbringender Meteroidenschweif jegliches Aufbegehren, dem eigenen Leben einen positiven Drall zu geben, hinfort wischt. Wer seine Eltern verliert oder gar das eigene Kind, stellt seine Ernährung nicht auf Paleo um, wer nach langer Krankheit oder einer Verletzung wieder ins Leben zurück robbt, der geht vielleicht erst einmal nicht die energetische Haussanierung an. Anders betrachtet können aber auch Schicksalsschläge positive Impulse der Veränderung liefern, findet Veränderung auf verschiedenen Ebenen statt und – jetzt kreist es etwas – verändern sich die Dinge unter der Art und Weise, wie wir sie betrachten. Ein Magengeschwür kann einen radikalen Schnitt hin zu einer gesünderen Lebensführung initiieren, die am Ende das im Verborgenen geschundene Herz- Kreislaufsystem vor dem finalen Kollaps bewahrt. Und deshalb: Changemanagement! Hey!!! Ergib Dich nicht Deinem Schicksal, gestalte es! Begegne den Schnitt-, Lupen- und Weichenstellen des Lebens mit Strategien, die das Unvorhersehbare kalkulierbar machen und den, den es trifft, unerschrocken und bereit! Hier gibt es für jeden Persönlichkeitstyp die maßgeschneiderte Management- und Motivationsfibel von irgendeinem US-amerikanischen Erfolgsautoren oder -autorin, ja, der oder die das Leben jener, der sie lasen, Du ahnst es, nicht nur gestreift, sondern fundamental verändert hat. Entlehnt sind die Strategien gerne aus der Welt der Tiere, wo die Dinge nicht so entartet und ungeordnet erscheinen, sondern klaren Instinkten des Selbsterhaltes folgen. Für die hysterischen Menschen, die in der Krise overpacen, gibt es die Bärenstrategie. Sie mahnt zu mehr Gelassenheit. Für die hadernden Menschen, die sich mit den Auswirkungen von Veränderungen nicht abfinden können, gibt es Bücher wie die Pinguin- oder die Mäusestrategie. Letzteres hat mir mal eine ganz frische Exfreundin zu Postgraduiertenzeiten geschenkt, um mir über den Schmerz der Trennung, den sie mir selbst bereitet hatte, hinwegzuhelfen. Ich glaube, es waren vier Mäuse, die sich in einem platon’esken Höhlensetting damit konfrontiert sahen, dass ihre Käsevorräte verschwunden waren. Die einen zogen die Turnschuhe an und rannten gleich los [das ist guut!!], die anderen blieben in ihrer Kammer und bejammerten den Verlust [das ist schleecht!!]. Irgendwann zogen auch die Jammernden los und konnten dann die tiefgreifenden Erkenntnisse, die ihnen die entschlosseneren Artgenossen an die Wände der Gänge geschrieben haben, auf ihrem Weg zu neuem Käse oder was auch immer lesen. „Du musst riechen, wenn der Käse alt ist!“ Für meine Verlustbeschwerden war es am Ende dann doch ganz brauchbar, die literarische Unterforderung habe ich versucht, nicht als finale Beleidigung meines Verstandes zu verstehen.
Manchmal keimt der Wunsch zur Veränderung ganz unbeeinflusst in uns selbst, intrinsisch und nicht minder innig. Wir wollen uns neu erfinden, mit neuen Attributen versehen. Die naheliegenden Fragen sind hier: gelingt das und wenn ja, wie oft und wenn nein, warum eigentlich nicht? Wieviel Aktivationsenergie braucht es, um das Vehikel unseres Selbst aus dem Orbit seiner Begrenzungen zu schießen? Und wo treibt es einen dann hin? Und wenn die Energie nicht reicht, ja gar nicht reichen kann, um einen Menschen aus dem Trägheitsbereich zu tragen, der ihn letztlich konstituiert, sodass man sich immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen füllt, wie geht man mit dieser Erkenntnis dann um? Ich weiß das auch alles nicht. Auch ich bleibe ein Suchender. Nur möchte ich dabei weniger verkrampfen. Vielleicht die Bärenstrategie?
PS: Dieser Artikel erschien erstmalig in der 14. Ausgabe des VONWEGEN-Magazins im Oktober 2018.
Ihr mögt unseren Stoff zum Reinziehen?
Dann spendet uns gerne ein paar Kröten in unsere Kaffeekasse. ♥
Weiterschmökern auf der Startseite...